Gedanken Erwachsener
Der Sterbeweg eines jeden Erkrankten ist individuell. Man sagt auch, dass jeder stirbt, wie er gelebt hat. Offene Menschen reden viel über ihre Gedanken und Vorstellungen vom Tod, während Verschlossene weniger von ihren Empfindungen preisgeben. Für einige ist der Umgang mit der Diagnose leichter, für andere schwerer. Fast alle haben zuerst eine Hoffnung auf Besserung.

Mit Bekanntgebung der Todesdiagnose fangen auch gleichzeitig die fünf Sterbephasen nach Kübler-Ross an:
1. - Nicht-Wahrhaben-Wollen (und Isolierung):
Diese Phase wird auch Schockphase genannt, hier reagieren die Erkrankten mit Verleugnung, Empfindungslosigkeit und/oder körperlichen Beschwerden, welches eine Schutzreaktion ist. Es sollte besonders auf die Wünsche der Erkrankten eingegangen werden, dazu zählt auch, sie nicht zu einem Gespräch zu drängen, sondern die nötige Zeit zu geben.
2. – Zorn:
In dieser Phase treten oft Aggressionen, Wut, Zorn und Schuldzuweisungen auf, welche sich nicht nur gegen den Betroffenen selber, sondern auch vielmals gegen die Angehörigen richten, auf. Geprägt von Gefühlen wie Ruhelosigkeit, Angst, Traurigkeit aber auch teilweise Freude, gehört dies zum Verarbeitungsprozess des Erkrankten.
3. – Verhandeln:
Am Wichtigsten ist in dieser Phase das Zuhören. Der Betroffene äußert womöglich unrealistische Wünsche und spricht über neu geschöpfte Hoffnung, welche man ihm auf keinen Fall wegnehmen darf. Zu unrealistische Wünsche dürfen jedoch auch nicht unterstützt werden. Die Meinung der Angehörigen ist in dieser Phase größtenteils ungefragt, denn die Erkrankten sind meist nur mit ihren eigenen Wünschen und Gedanken beschäftigt.
4. – Depressionen:
Um in dieser Phase als Angehöriger förderlich zu sein, sollte das Zuhören und die Gesprächsführung an erster Stelle stehen. Sehr oft empfinden die Betroffenen Gefühle tiefer Traurigkeit und große Angst vor dem Bevorstehenden. Sie brauchen eine Schulter zum Anlehnen, jemanden, der ihnen in dieser Zeit nahe steht und zeigt, dass Trauern keineswegs falsch ist oder etwas, wofür man sich schämen muss.
5. – Zustimmung:
Nicht alle Erkrankten erreichen die letzte Phase, in welcher sie ihr Schicksal akzeptieren und friedlich ihre letzte Lebenszeit genießen können. Der Betroffene erreicht einen Zustand, welcher ziemlich gefühllos wirken kann. Auch der Wunsch nach Nähe und Gesprächen ist fast komplett erloschen, denn der Erkrankte wendet seinen Blick in andere Richtungen. Trotzdem können die Angehörigen mit Hilfe von Worten und kleinen Taten Mut spenden und womögliche Angst lindern.
Das Verhalten der Betroffenen richtet sich nach den oben genannten Phasen, jedoch müssen diese nicht chronologisch auftreten, ein Hin- und Herspringen ist möglich und tritt häufig auf. Der endgültige Todeszeitpunkt liegt nicht zwingend in der letzten Sterbephase, sondern kann in jeder vorherigen Phase eintreten. Auch ist die Laune des Erkrankten tagesabhängig und kann trotz bestimmter Phase stark variieren; manchmal befindet sich der Betroffene in einem Hoch und manchmal in einem Tief.
Einige wenige Erkrankte sehen den Tod scheinbar nicht als schlimm an, da sie ihr Leben nicht als erfüllt empfinden und es nur noch wenig Lebensqualität besitzt. Fraglich ist hierbei aber, ob das die Wahrheit ist, denn solche Erkrankten reden nicht gerne über ihre Gefühle. Andere hingegen brauchen viele Monate der Zuwendung.
Das Sterben ist ein Prozess, dessen Ablauf der Betroffene selber entscheidet. Vielfach wird er hierbei von spirituellen Fragen geleitet „Wo gehe ich hin?/Wo komme ich her?“. Erkrankte Erwachsene verspüren oftmals den Wunsch, Spuren zu hinterlassen. Sei dies durch eigene Kinder oder den Anschluss an ein soziales Projekt oder die Gründung eines eigenen. Zusätzlich ziehen sie alleine oder mit anderen eine Bilanz über ihr Leben.
Ein Teil der Erkrankten lässt das Lebensende auf sich zukommen, während andere durch ihre Verhaftung im Glauben eine klare Vorstellung vom Tod besitzen, genauso wie Frau S. (Interviews mit Sterbenden – Elisabeth Kübler-Ross). Diese wollte für ihre Familie stark sein, hat deshalb jegliche Anzeichen einer Krankheit verdrängt und ging nicht zum Arzt, weil sie die Normalität in ihrem Leben bewahren und unabhängig sein wollte. Als sie jedoch trotzdem ihre Todesdiagnose bekam, reagierte sie mit einem seelischen Zusammenbruch. An den bevorstehenden Tod verschwendet sie kaum einen Gedanken, denn sie lebt für ihre Familie weiter und der Glaube und das Beten geben ihr die nötige Kraft, die sie braucht.
Die Erkrankten machen sich Gedanken über den Ablauf des Todes und die Zeit danach; „Wird alles dunkel?/Sehe ich mir bekannte Verstorbene wieder?/Wie wird es allgemein?“. Sie sprechen Wünsche über ihren Tod aus, welche oft schmerzfreies Sterben und Entlastung für die Angehörigen sind, was von Lebensmüdigkeit begleitet wird. Sind die Erkrankten sich komplett im Klaren über ihren nahenden Tod, erledigen sie noch ausstehende Aufgaben wie z.B. das Schreiben eines Testaments oder der Patientenverfügung, falls sie in einem Hospiz untergebracht sind. Zusätzlich spielt die Symbolsprache in der letzten Lebenszeit eine wichtige Rolle, beispielsweise das Aufziehen einer alten Taschenuhr (meine Zeit ist noch nicht abgelaufen), das Packen der Koffer (ich begebe mich auf eine Reise) oder das Verschenken von Dingen.
Wenn es den Betroffenen durch ihre Krankheit immer schlechter geht, stellen sich sowohl die sozialen als auch die körperlichen Funktionen langsam ein. Die Körperenergie nimmt ab, der Erkrankte braucht viel Schlaf und Ruhe, er schläft mehr, als dass er wach ist. Er zieht sich von der Außenwelt zurück und kapselt sich immer mehr ab, auch sein Sprachbedürfnis wird mit der Zeit viel weniger. In dieser schweren Zeit wollen die Betroffenen nur ihnen vertraute Personen um sich haben, welche sie aber möglicherweise später nicht mehr erkennen. Eventuell zeigen sie weniger Interesse oder verlieren komplett den Bezug zur Realität und ihr Zeitgefühl. Oft ist Stille für die Erkrankten kurz vor ihrem Tod wichtiger als Worte, denn diese gibt ihnen Kraft. Sie fragen sich nach der verbleibenden Lebens- und Leidenszeit und sind kurz vor ihrem Tod noch einmal aufgeweckt und nehmen ein letztes Mal am Leben teil. Die Nahrungsaufnahme wird oft verweigert, da diese ihnen nur Leid zufügt und Schmerzen bereitet. Doch von diesen wird der Erkrankte im Zeitpunkt seines Todes erlöst.
Gedanken Schwerkranker: Kinder
Für Eltern und Angehörige ist es oftmals schwer zu begreifen, dass sie in dem Wissen leben müssen, dass ihr Kind bald stirbt. Doch die Kinder hingegen nehmen ihre Diagnose so hin, wie es ist und machen es den Eltern so, durch dieses schnelle Akzeptieren, leichter. Ihr Umgang mit dem Tod ist generell offener als der der Erwachsenen.

Stille Kleinkinder drücken sich oftmals mit Zeichnungen aus und zeigen so ihre Gefühle und Gedanken. Diese Zeichnungen sind häufig mit dunklen Farben gemalt, welche den Tod darstellen. Die Kinder malen einfach und haben die Bedeutung vielleicht im Unterbewusstsein und denken nicht so viel über die mögliche Deutung ihrer Bilder nach. Außerdem wehren sich die Kinder an einem bestimmten Zeitpunkt gegen die Krankheit durch Aggression, Abwehr und Regression. Dieses lässt das Kleinkind nicht nur an seinen Mitmenschen aus, sondern zeigt diese Wut der Krankheit gegenüber auch durch Puppenspiele. Die Kinder werden gerne von ihren Eltern und Betreuern durch Geschichten oder Märchen abgelenkt, diese werden in letzten Lebenstagen nur noch auf die wichtigsten Handlungen reduziert. Wie bei den Erwachsenen sieht man, dass sie an der Normalität festhalten wollen und Rituale und Gewohnheiten möglichst eingehalten werden sollten.
Kinder im Grundschulalter gehen sehr offen mit dem Tod und der Diagnose um, denn sie sind sich in den meisten Fällen im klaren darüber, dass sie sterben werden. Für die Kinder ist es oft leichter zu begreifen als für ihre Eltern. Diese Kinder wollen genaue Informationen zum Fortschritt ihrer Krankheit und über alle medizinischen Versorgungen Bescheid wissen, denn sie mögen es nicht uninformiert zu sein. Bemerkenswerterweise sind sie trotz ihrer tödlichen Krankheit in der Lage den Moment zu genießen, jedoch werden sie manchmal auch traurig wenn sie über nicht erlebte Dinge nachdenken. Sie verarbeiten diese schwere Zeit mit Hilfe von Gesprächen mit vertrauten Personen, denn das macht es leichter für sie. Falls an einer Therapie teilgenommen wird, wird dieses oft nur für die Eltern gemacht, da es ihnen die Situation erleichtert. Die älteren Kinder haben häufig eine sehr klare Vorstellung vom Tod, die aber von Kind zu Kind sehr individuell ist.
Jugendliche kommen in der Sterbephase ihrer Familie noch näher, da diese sie sehr unterstützen und sie es ohne ihre Familie nicht schaffen würden. Sie wollen es ihnen leicht machen, denn in häufigen Fällen ist ihnen das Wohl der Familie wichtiger als ihr eigenes. Außerdem sind sie sehr hilfsbereit und versuchen es allen recht zu machen. Auch die Jugendlichen wollen, wie die Kinder im Grundschulalter, Klarheit über ihre Krankheit und das nichts verschönt wird. Die genauen Informationen zu der Krankheit wollen sie direkt vom Arzt hören und nicht übermittelt durch die Eltern erfahren. Jugendliche die schon vor ihrer Diagnose gläubig waren, haben eine klare Vorstellung vom Tod; z. B. stellen sie es sich wie ein großartiges, großes Treffen vor, bei dem sie bereits Verstorbene wiedersehen. In Einzelfällen finden sie erst in der Sterbephase zu Gott, der ihnen Kraft schenkt.
Am Rande aller Gedanken leiten auch spirituelle Fragen den Sterbeprozess: "Wo komme ich her? Wo gehe ich hin?" Nach dem Tod des Kindes sollten sich die Eltern Unterstützung suchen, damit sie neue Lebensziele entwickeln können und sie nicht dauerhaft ihrem Kind nachtrauern.
Angehörige
Im Sterbeprozess eines Schwerkranken spielen die Angehörigen mit die wichtigste Rolle, da sie die Hauptlast tragen. Zu ihnen zählt man nicht nur die Familie sondern auch Freunde und Bekannte, welche fast genauso viel Unterstützung und Hilfe wie die Erkrankten selbst benötigen. Es ist für beide Seiten eine belastende Zeit.

Für die Angehörigen ist es oft leichter in der Gegenwart zu leben und sich nicht zu sehr auf die bevorstehende Zeit zu konzentrieren, da durch die entstehenden Gedanken über die Zukunft der Tod des Betroffenen häufig dramatisiert wird.
Auf dessen Diagnose reagieren die Angehörigen oftmals mit wechselnden Gefühlen zwischen Hoffnung und Angst, Akzeptanz und Agressionen, was daraufhin deutet, dass sie die schreckliche Diagnose nicht akzeptieren bzw. wahrhaben wollen. Gleichzeitig durchlaufen sie einen emotionalen Prozess, der stetig zwischen Fortschritt und Rückschritt, Entwicklung und Stillstand schwankt.
Vielfach stellen sie sich Fragen, die einerseits sie selber betreffen ("Wie lange halte ich der Belastung noch stand?"/ "Wie lange halte ich allgemein noch durch?"), aber auch den Erkrankten ("Wann wird mein geliebter Mensch von seinem Leid erlöst?"), sowie weitere organisatorische Fragen zur Pflege.
In manchen Fällen versuchen die Angehörigen ihre Gedanken und Gefühle vor den Menschen in ihrer Umgebung zu verbergen, da sie diese als unangenehm empfinden und Angst haben, von Anderen als schwach oder instabil wahrgenommen zu werden. Außerdem wollen sie dem Betroffenen gegenüber so eine bessere Unterstützung bieten.
Wichtig ist, dass die Angehörigen während des Sterbeprozesses nicht nur ihre ganze Zeit in den Erkrankten investieren, sondern sich auch bewusst Zeit für sich selber nehmen, z. B. um sich mit Freunden oder anderen Familienmitgliedern zu treffen. Diese Zeit mit vertrauten Menschen hilft ihnen, wieder Kraft zu gewinnen, welche sie für den Umgang mit dem Betroffenen benötigen. Sie können sich bei Personen aus ihrem näheren Umfeld Hilfe holen, obwohl sie häufig der Meinung sind, dass das nicht der richtige Weg sei und sie alles alleine bewältigen müssten.
Den Sterbeweg sollten die Angehörigen mitgehen, egal ob sie ihn als richtig oder falsch ansehen. Ebenfalls müssen sie die Wünsche des Erkrankten berücksichtigen und akzeptieren, sowie ihre eigenen in den Hintergrund stellen. Dazu gehört auch die Verweigerung der Nahrungsaufnahme, die den Betroffenen eher leiden lässt, als dass sie ihm hilft. Falls der Betroffene in seinen letzten Lebensstunden ins Koma fällt, sollten die Angehörigen trotzdem noch normal mit ihm sprechen und ihm seine letzten Nachrichten überbringen, da der Gehörsinn als letztes verloren geht. Wenn es dann zum Tod kommt, geht der Betroffene oft zu einem Zeitpunkt an welchem er alleine ist, weil es so möglicherweise leichter für ihn ist. Die Angehörigen haben häufig Schuldgefühle, wenn sie in diesem Moment nicht bei dem Erkrankten sind und denken "Jetzt habe ich sie im Stich gelassen, im wichtigsten Zeitpunkt ihres Lebens?/ Warum bin ich nicht noch geblieben?; Warum habe ich stattdessen lieber etwas anderes gemacht?".
Nach dem Tod sollten sich die Angehörigen viel Zeit nehmen, um den Tod zu realisieren und Abschied zu nehmen. Haben sie den Verlust verkraftet, müssen sie sich um die Bestattung kümmern, in dieser gesamten Zeit denken die Angehörigen sehr intensiv auch über ihren eigenen Tod nach. Doch trotzdem sollten sie im Verlauf der Sterbezeit ihr Lachen nicht verlieren, denn sie können rückblickend an alle schönen Erinnerungen mit dem Verstorbenen denken.
Hospizliche Betreuung
Die Betroffenen in der letzten Lebensphase bzw. Sterbephase und die Angehörigen fällen oft gemeinsam die Entscheidung, ob ein Hospiz besucht wird. Meistens sind die familiären Umstände wie z. B. zu junge Kinder, kein Lebensgefährte oder labile Angehörige ein ausschlaggebender Grund. Wenn es die familiären Umstände zulassen und der Wunsch nach dem Sterben zu Hause groß ist, ist eine häusliche hospizliche Betreuung möglich.

Wenn die Angehörigen nicht mehr weiter wissen oder keine Kraft mehr haben, benötigen sie oft Hilfe und fordern eine hospizliche Hilfe an. Anschließend führt der Hospizleiter ein Erstgespräch mit dem Betroffenen und den Angehörigen und weist einen passenden Betreuer zu. Diese Betreuung findet monatlich oder wöchentlich statt, je nach Wunsch des Erkrankten und geht bis zu seinem Lebensende.
"Der Sterbende führt Regie" (Zitat: Sabine Ahrens, Leiterin vom Hospizverein Loxstedt), so könnte der Tagesablauf der Betreuung beschrieben werden, denn es richtet sich komplett nach dem Betroffenen und es werden alle im Rahmen stehenden möglichen Wünsche erfüllt. Hierbei müssen die der Angehörigen sehr stark im Hintergrund stehen. Die Wünsche der Erkrankten sind häufig keine großen, sondern eher kleinere wie beispielsweise gemeinsames Einkaufen, Kaffee trinken im ehemaligen Liebligscafé oder der Besuch eines Gottesdienstes. Bei diesen sonst alltäglichen Aktivitäten entstehen oftmals sehr tiefgründige Gespräche über das noch verbleibende Leben und die Vorstellung vom Tod. Auch die Symbolsprache verdeutlicht das Umgehen mit dem Thema Tod (siehe Gedanken Schwerkranker: Erwachsene). In der Zeit kurz vor dem Tod häufen sich die Besuche, die auch teilweise aus Nachtwachen bestehen, was dem Betroffenen zeigt, dass sie immer eine Hand am Bett oder eine vertraute Person um sich haben. Bei den Besuchen entwickeln sich des Öfteren auch Gespräche zwischen den Betreuern und den Angehörigen, welche dadurch auf den Tod und die Sterbephasen vorbereitet werden.
Fällt man die Entscheidung für ein stationäres Hospiz, kann man sich dies folgendermaßen vorstellen:
In 8 bis 12-Betten-Häuser haben die Erkrankten Einzelzimmer, in welchen die Angehörigen mit schlafen können oder auch in den vorhandenen Gästezimmern.
In einem Hospiz geht es hauptsächlich um die Erhaltung der Lebensqualität, sowie um die Symptomlinderung. Die Tagesabläufe der Betroffenen sind nicht streng geregelt, sondern laufen alle individuell ab und sind auch hier an deren Wünsche angepasst. Der Betroffene sucht den Kontakt zu anderen von sich selber aus und man sollte ihn nicht zu Gesprächen drängen. Diese Gespräche sind über das Alltägliche und letzte Dinge, die sie noch erleben wollen, wie z. B. ein Besuch des Hafens, sich vorlesen lassen aus der Zeitung, die Bestattung oder um andere wichtige Angelegenheiten zu klären. In einem stationären Hospiz werden die Angehörigen auch betreut und können mit den Pflegern oder Betreuern offen über alles reden.
Nach dem Tod des Erkrankten können sich die Angehörigen einer Trauergruppe oder einer Selbsthilfegruppe anschließen. Dieses ist aber eher der Weg der vorher nicht hospizlich betreuten Angehörigen. Bereits Betreute kennen gute Methoden und Möglichkeiten mit dem Tod des Betroffenen besser umzugehen, da sie in der Sterbephase schon mit der Verarbeitung ihrer Trauer begonnen haben.
Jeder hat die Möglichkeit einer hospizlichen Betreuung und sollte diese ergreifen, denn man sagt "Im Hospiz wird schöner gestorben" (Zitat: Sabine Ahrens).
Reaktionen von Gleichaltrigen
Nicht nur für die Erkrankten, sondern auch für gleichaltrige Freunde oder Mitschüler ist die Nachricht, dass eine ihnen nahestehende Person schwer erkrankt ist, eine schockierende. Man sagt, die Umwelt erkrankt meist unbewusst mit und das Ganze sollte als sehr sensibles Thema behandelt werden.

Die Betroffenen wollen es oftmals nicht bekannt geben und darüber reden, da sie Angst haben, dass sie anders angesehen und behandelt werden. Der Wunsch jedes Erkrankten ist es für gewöhnlich, weiterhin so normal behandelt zu werden wie vorher und sein Leben auch normal weiterzuführen.
Die Menschen in der Umgebung schauen entweder weg, weil sie nicht wissen, wie sie mit der Diagnose umgehen sollen oder meiden den Betroffenen generell. Sie haben Angst und sind sich unsicher, wie sie dem Erkrankten gegenübertreten sollen.
Oder es tritt das komplette Gegenteil ein und die Menschen in der Umgebung sind besonders zugänglich und fürsorglich im Umgang mit dem Betroffenen, was jedoch auch nicht die passende Art der Behandlung ist.
Am besten sollte man den Erkrankten genauso behandeln wie vorher, auch wenn das oft schwerfällt, um ihm die von ihm gewünschte Normalität nicht wegzunehmen.
Man soll offen mit dem Betroffenen reden und die Gefühle (wie etwa Hilflosigkeit und Verzweiflung) liebevoll ausdrücken aber nicht verschönern. Der Erkrankte kann das annehmen oder mit Sätzen wie ("Lass mich in Ruhe, du hast sowieso keine Ahnung!"/"Du kannst mich doch eh nicht verstehen.") reagieren. Der Freund darf das aber nicht persönlich nehmen, denn die schroffen Antworten sind eine Reaktion auf den Gedanken, dass die anderen ein erfülltes und langes Leben führen können.
Das hat nichts mit den Mitmenschen an sich zu tun, es liegt viel mehr an der Krankheit und der damit verbundenen Wut und Aggression, welche solch eine Reaktion hervorrufen. Hierbei sind auch die Sterbephasen gut erkennbar.
Andere Betroffene sind ganz abgeklärt und sich im Klaren darüber, dass sie ein verkürztes Leben führen und genießen dieses in vollen Zügen.
Wenn die Erkrankung nicht mehr zu verheimlichen ist, die Eltern oder der Erkrankte es von sich aus erzählt oder man es dem Lehrer erzählt, sollte man dies erst einmal gut und untereinander im kleinen Rahmen tun. Als Lehrer sollte man den Schüler zuerst in einem persönlichen Gespräch fragen, ob es für ihn in Ordnung wäre, die Erkrankung bekanntzugeben.
Generell kann man sagen, dass man jederzeit offen und bereit für ein Gespräch mit dem Erkrankten sein sollte und ihm signalieren soll, dass man immer für ihn da ist, falls er einen oder irgendwas braucht. Die Mitmenschen sollten den Betroffenen immer wieder nach dem Bedürfnis zu einem Gespräch fragen, dies aber nur in geringem Maße. Man muss aber auch akzeptieren, wie viel Offenheit der Betroffene von sich anbietet und ihn auf keinem Fall zu einem Gespräch zwingen.
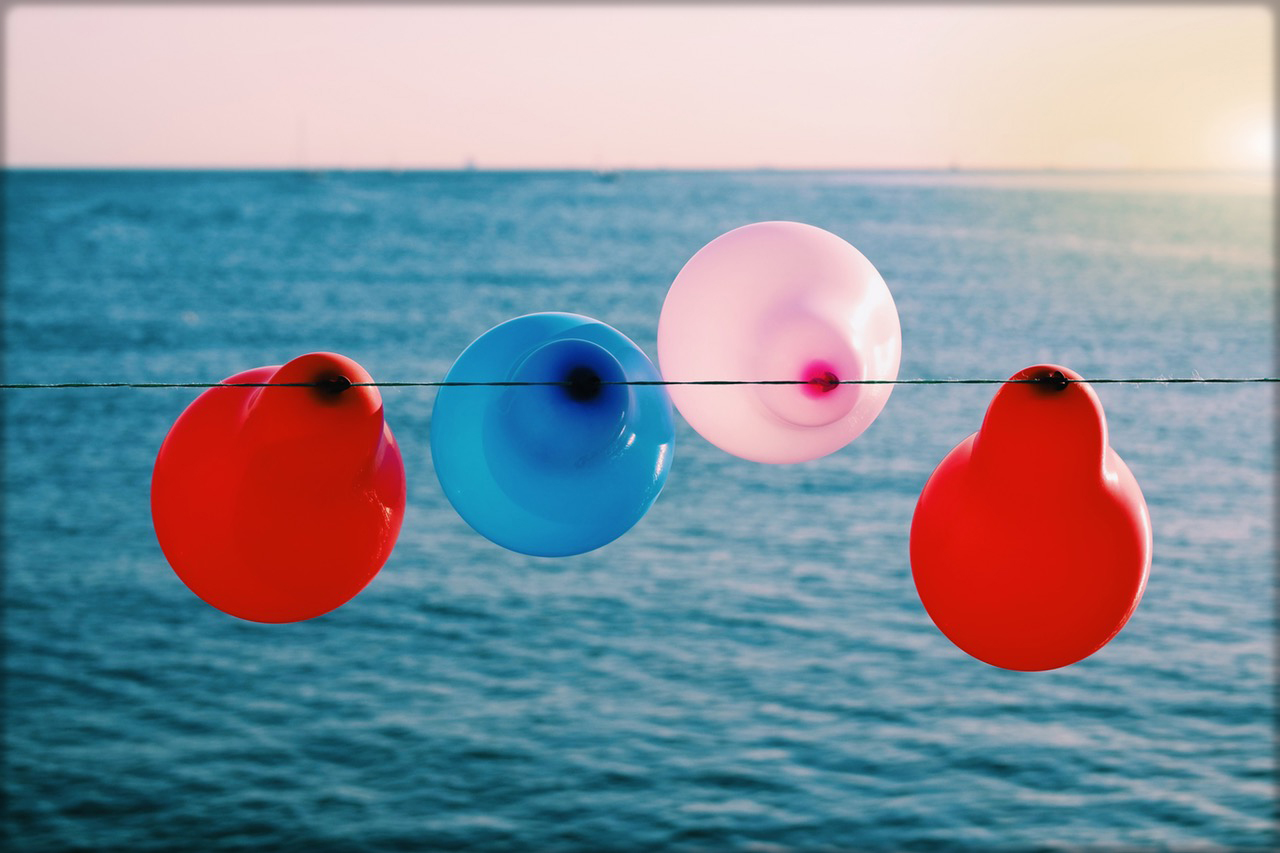
Beispiele für Erkrankungen
Bei den Erwachsenen treten am häufigsten diverse Krebserkrankungen (wie etwa Darmkrebs, Brustkrebs bei Frauen, Lungenkrebs und akute Leukämie) auf.
Wenn sich die Krankheit wesentlich verschlimmert und die Erkrankten keine Möglichkeit haben, von der Familie betreut zu werden, suchen sie sich oft Hilfe im Hospiz.
Bei der Erkrankung kann es dazu kommen, dass sich Metastasen bilden, welche sich über Blut und Lymphe ausbreiten und je nach Krebsart an bevorzugten Körperstellen entwickeln. Die Krebserkrankungen verlaufen im Durchschnitt kürzer und akuter.
Im neurologischen Bereich sind häufig Krankheitsbilder wie Multiple Skerose (MS), Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) und Parkinson zu erkennen. Diese verlaufen über viele Jahre und verschlechtern sich in ihrer Fortschreitung. Deshalb ist auch die Begleitung eines von diesen Krankheiten betroffenen Menschen schwierig.
Auch häufig treten chronische obstruktive Lungenerkrankungen (COPD) bei starken und lebenslangen Rauchern auf. Das Lungengewebe wird bei COPD so stark beschädigt, dass es zu Atembeschwerden führen kann. Bei diesen Erkrankungen sind oft Begleitungen nötig, ob durch Familie, Freunde oder ein Hospiz. Ebenso findet man unter den Erkrankten gelegentlich schwere und chronische Nierenerkrankungen.
Als typische Nebenwirkungen treten Luftnot bei COPD und Lungenkarzinomen, Juckreiz, Appetitlosigkeit und generell starke Schmerzen auf. Wenn der Schmerz eingestellt ist, beginnen erst die Ängste und Depressionen, welche oftmals schwieriger zu bekämpfen sind als die Schmerzen selber.
Der Gedanke, dass bei Kindern auch der Krebs die häufigste Erkrankung ist, ist falsch, denn die meisten Kinder erkranken an Stoffwechsel- oder genetischen Erkrankungen. Diese führen zu schweren Krankheitsverläufen und verkürzen somit das Leben der Kinder.
Oft sind es jedoch auch Kinder, welche von Geburt an behindert sind. Oder Behinderungen im Laufe ihres Lebens durch Krankheiten oder Unfälle bekommen. Diese Kinder sind oft mehrfach behindert (psychisch und/oder physisch) und haben aufgrund ihrer Beeinträchtigung mit einer verkürzten Lebenszeit zu rechnen.
Wenn Kinder jedoch an Krebs erkranken, sind es meistens Blutkrebsarten, ein Hirntumor und bei Jugendlichen vermehrt Krebs in den Knochen. Dieses sind bundesweit zahlenmäßig gesehen die häufigsten Erkrankungen.
Über uns
Wir, Tabea Piesik und Svea Ideler, gehen auf die Geschwister-Scholl-Schule in Bremerhaven und besuchen die erste Qualifikationsphase. Die Leistungskurse von Tabea sind Englisch und Psychologie und Sveas sind Biologie und Psychologie. Im Rahmen unseres Profilkurses Psychologie findet eine Profilarbeit statt, welche unter das Oberthema "Traum und Wirklichkeit" fällt. Wir haben uns innerhalb dieses Themas mit der Fragestellung "Lebensmut trotz Todesdiagnose? - Wie Schwerkranke mit Leben und Tod umgehen" beschäftigt. Diese Homepage ist das Ergebis unserer Profilarbeit.
Quellen
Wir haben die Informationen aus den Quellen genutzt, jedoch sind die Texte eingenhändig verfasst. Die Quellen sind nach Text und einzelnen dort vorkommenden Abschnitten geordnet.
Gedanken Schwerkranker
Erwachsene
Einleitung:
- Interview mit Sabine Ahrens aus dem Hospizverein Loxstedt (28.11.2016)
- Interview mit Doris Steinkamp aus dem Hombre Bremerhaven (05.12.2016)
Erster Abschnitt:
- Kübler-Ross, Elisabeth (1969). „Interviews mit Sterbenden“. Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München
- http://christoph-student.homepage.t-online.de/Downloads/Sterbephasen.pdf (2006)
Zweiter Abschnitt:
- Interview mit Doris Steinkamp aus dem Hombre Bremerhaven (05.12.2016)
- Interview mit Sabine Ahrens aus dem Hospizverein Loxstedt (28.11.2016)
Dritter Abschnitt:
- Interview mit Doris Steinkamp aus dem Hombre Bremerhaven (05.12.2016)
Vierter Abschnitt:
- Interview mit Doris Steinkamp aus dem Hombre Bremerhaven (05.12.2016)
Fünfter Abschnitt:
- Kübler-Ross, Elisabeth (1969). „Interviews mit Sterbenden“. Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München
- Interview mit Doris Steinkamp aus dem Hombre Bremerhaven (05.12.2016)
Sechster Abschnitt:
- Interview mit Doris Steinkamp aus dem Hombre Bremerhaven (05.12.2016)
- Interview mit Sabine Ahrens aus dem Hospizverein Loxstedt (28.11.2016)
Siebter Abschnitt:
- http://www.palliativnetzwerk-mainz.de/Patientenratgeber/Wenn-der-Tod-sich-ankundigt/wenn-der-tod-sich-ankundigt.php
- Dr. Tausch, Daniela und Bickel, Lis (2006). „Die letzten Wochen und Tage - Eine Hilfe zur Begleitung“. Diakonisches Werk und Krebsverband Baden-Württemberg e.V.
- Interview mit Doris Steinkamp aus dem Hombre Bremerhaven (05.12.2016)
Kinder
Einleitung:
- Interview mit Doris Steinkamp aus dem Hombre Bremerhaven (05.12.2016)
Erster Abschnitt:
- Leuenberger, Madeleine. „Was sterbende Kinder denken“. In: Fässler-Weibel, Peter (2008). „Wenn Kinder sterben“. Verlagsgemeinschaft topos plus, Kevelaer
- Interview mit Sabine Ahrens aus dem Hospizverein Loxstedt (28.11.2016)
Zweiter Abschnitt:
- Interview mit Doris Steinkamp aus dem Hombre Bremerhaven (05.12.2016)
Dritter Abschnitt:
- Kübler-Ross, Elisabeth (1969). „Interviews mit Sterbenden", Kapitel 10. Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München
- Interview mit Sabine Ahrens aus dem Hospizverein Loxstedt (28.11.2016)
Vierter Abschnitt:
- Interview mit Doris Steinkamp aus dem Hombre Bremerhaven (05.12.2016)
Angehörige
Einleitung:
- Interview mit Doris Steinkamp aus dem Hombre Bremerhaven (05.12.2016)
Erster Abschnitt:
- Dr. Tausch, Daniela und Bickel, Lis (2006). „Die letzten Wochen und Tage - Eine Hilfe zur Begleitung“. Diakonisches Werk und Krebsverband Baden-Württemberg e.V.
Zweiter Abschnitt:
- Leuenberger, Madeleine. „Was sterbende Kinder denken“. In: Fässler-Weibel, Peter (2008). „Wenn Kinder sterben“. Verlagsgemeinschaft topos plus, Kevelaer
Dritter Abschnitt:
- Dr. Tausch, Daniela und Bickel, Lis (2006). „Die letzten Wochen und Tage - Eine Hilfe zur Begleitung“. Diakonisches Werk und Krebsverband Baden-Württemberg e.V.
- Interview mit Sabine Ahrens aus dem Hospizverein Loxstedt (28.11.2016)
- Interview mit Doris Steinkamp aus dem Hombre Bremerhaven (05.12.2016)
Vierter Abschnitt:
- Leuenberger, Madeleine. „Was sterbende Kinder denken“. In: Fässler-Weibel, Peter (2008). „Wenn Kinder sterben“. Verlagsgemeinschaft topos plus, Kevelaer
- Interview mit Sabine Ahrens aus dem Hospizverein Loxstedt (28.11.2016)
Fünfter Abschnitt:
- Dr. Tausch, Daniela und Bickel, Lis (2006). „Die letzten Wochen und Tage - Eine Hilfe zur Begleitung“. Diakonisches Werk und Krebsverband Baden-Württemberg e.V.
- Interview mit Doris Steinkamp aus dem Hombre Bremerhaven (05.12.2016)
Sechster Abschnitt:
- Dr. Tausch, Daniela und Bickel, Lis (2006). „Die letzten Wochen und Tage - Eine Hilfe zur Begleitung“. Diakonisches Werk und Krebsverband Baden-Württemberg e.V.
- Interview mit Sabine Ahrens aus dem Hospizverein Loxstedt (28.11.2016)
Siebter Abschnitt:
- Dr. Tausch, Daniela und Bickel, Lis (2006). „Die letzten Wochen und Tage - Eine Hilfe zur Begleitung“. Diakonisches Werk und Krebsverband Baden-Württemberg e.V.
- Interview mit Sabine Ahrens aus dem Hospizverein Loxstedt (28.11.2016)
- Interview mit Doris Steinkamp aus dem Hombre Bremerhaven (05.12.2016)
Hospizliche Betreuung
Einleitung:
- Interview mit Sabine Ahrens aus dem Hospizverein Loxstedt (28.11.2016)
Erster Abschnitt:
- Interview mit Sabine Ahrens aus dem Hospizverein Loxstedt (28.11.2016)
Zweiter Abschnitt:
- Interview mit Sabine Ahrens aus dem Hospizverein Loxstedt (28.11.2016)
- Interview mit Doris Steinkamp aus dem Hombre Bremerhaven (05.12.2016)
Dritter Abschnitt:
- Interview mit Doris Steinkamp aus dem Hombre Bremerhaven (05.12.2016)
Vierter Abschnitt:
- Interview mit Doris Steinkamp aus dem Hombre Bremerhaven (05.12.2016)
- Interview mit Sabine Ahrens aus dem Hospizverein Loxstedt (28.11.2016)
Fünfter Abschnitt:
- Interview mit Doris Steinkamp aus dem Hombre Bremerhaven (05.12.2016)
Sechster Abschnitt:
- Interview mit Sabine Ahrens aus dem Hospizverein Loxstedt (28.11.2016)
Reaktionen von Gleichaltrigen
- Interview mit Doris Steinkamp und eigene Gedanken.
Beispiele für Erkrankungen
- Interview mit Doris Steinkamp und eigene Gedanken.
Hilfe finden
An folgenden Standorten können Sie Hilfe finden:
https://sternenbruecke.de/home
Sternenbrücke
Sandmoorweg 62
22559 Hamburg
http://www.youth-life-line.de/ ("Internethilfe")
http://www.da-sein.de/start/ ("Internethilfe")
Lange Reihe 102
28219 Bremen
http://www.hospiz-bremerhaven.de/
Hombre Bremerhaven
Bülkenstr. 31
27570 Bremerhaven
http://www.hospizverein-loxstedt.de/
Hospizverein Loxstedt
Bahnhofstr. 53
27612 Loxstedt
http://www.selbsthilfe-buero.de/index.php?id=122&L=1%3Fhost%3Dwww.selbsthilfe-buero.de ("zum selbstsuchen")
Hospizdienst Oldenburg
Haareneschstr. 62
26121 Oldenburg
http://www.krisenfeste.de/
Krisenfest (Fest auf Anfrage)
Euckenstraße 15
28203 Bremen
http://www.trauertreff-sonnenblume.de/
Trauertreff Sonnenblume
Lange Str. 62
26919 Brake
https://www.trauergruppe.de/ ("Zum Selbstsuchen")